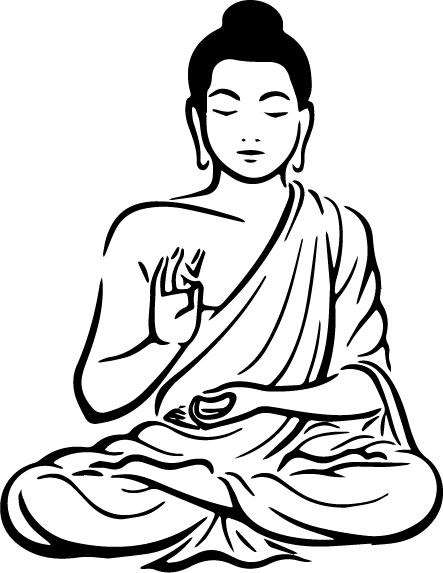Weniger als drei Wochen nach der feierlichen Unterzeichnung des „Kuala Lumpur Peace Accord“ zwischen Kambodscha und Thailand am 26. Oktober 2025 zeigt sich: Der Frieden ist äußerst fragil. Die jüngsten Ereignisse der letzten beiden Wochen haben die Hoffnungen auf eine dauerhafte Lösung des Grenzkonflikts wieder zunichtegemacht.
Als langjähriger Resident von Kambodscha verfolge ich diese Entwicklungen logischerweise mit Interesse, auch wenn man ausserhalb der Grenzregion nichts davon merkt. Was ist in den letzten 14 Tagen passiert, das den mühsam ausgehandelten Frieden bereits wieder gefährdet?
Das Friedensabkommen vom 26. Oktober – kurzer Rückblick
Zur Einordnung: Ende Oktober wurde am Rande des ASEAN-Gipfels in Kuala Lumpur unter Anwesenheit von US-Präsident Donald Trump eine Friedensvereinbarung zwischen Thailands Premierminister Anutin Charnvirakul und Kambodschas Premierminister Hun Manet unterzeichnet.
Die Vereinbarung beinhaltete:
- Militärische Deeskalation unter ASEAN-Beobachtung
- Entfernung schwerer Waffen von der Grenze
- Koordinierte humanitäre Minenräumung
- Freilassung von 18 kambodschanischen Kriegsgefangenen durch Thailand
- Zusammenarbeit gegen grenzüberschreitende Kriminalität
„Dies ist ein historischer Tag“, erklärte Hun Manet damals optimistisch. Die internationale Gemeinschaft feierte das Abkommen als Durchbruch. Doch die Euphorie sollte nicht lange halten.
10. November – Die Landmine
Am 10. November explodierte eine Landmine nahe der Grenze in der thailändischen Provinz Sisaket. Zwei thailändische Soldaten wurden schwer verletzt – einer verlor seinen Fuß. Der Vorfall ereignete sich nur wenige Meter von der Grenze entfernt.
Thailands Position: Die thailändische Regierung beschuldigte Kambodscha sofort, neue Minen gelegt und damit direkt gegen die Friedensvereinbarung verstoßen zu haben. Verteidigungskreise in Bangkok sprachen von einem „vorsätzlichen Akt der Aggression“ und einer „Missachtung des Kuala Lumpur Accords“.
Kambodschas Position: Das kambodschanische Verteidigungsministerium wies die Vorwürfe entschieden zurück. Es handele sich um alte Minen aus früheren Konflikten, möglicherweise aus den 1980er oder 1990er Jahren. Kambodscha sei Unterzeichner der Ottawa-Konvention gegen Landminen und habe seit Jahren keine neuen Minen mehr gelegt. Die Beschuldigungen seien „unbegründet und politisch motiviert“.
Die Fakten: Die Grenzregion zwischen beiden Ländern ist durchsetzt mit Landminen aus Jahrzehnten von Konflikten, sowohl aus dem Vietnamkrieg als auch aus dem Bürgerkrieg in Kambodscha und aus früheren Grenzscharmützeln. Eine eindeutige Zuordnung, wann eine Mine gelegt wurde, ist oft unmöglich.
Thailands Reaktion – Suspendierung des Friedensabkommens
Premierminister Anutin reagierte drastisch auf den Landminen-Vorfall. In einer Pressekonferenz am 11. November verkündete er:
„Die Feindseligkeit gegenüber unserer nationalen Sicherheit hat nicht abgenommen, wie wir dachten. Thailand suspendiert hiermit die Umsetzung des Friedensabkommens bis auf Weiteres.“
Konkret bedeutete das:
- Die für den 13. November geplante Freilassung der 18 kambodschanischen Kriegsgefangenen wurde abgesagt.
- Die gemeinsame Minenräumung wurde eingestellt.
- Das ASEAN-Beobachterteam wurde von thailändischer Seite nicht mehr an die Grenze gelassen.
- Die militärische Deeskalation wurde faktisch beendet.
Diese einseitige Entscheidung löste international Besorgnis aus. Malaysia als Vermittler und ASEAN-Vorsitzender appellierte sofort an beide Seiten, das Abkommen einzuhalten.
12. November – Schusswechsel in Prey Chan
Nur einen Tag später eskalierte die Situation erneut. Im umstrittenen Dorf Prey Chan an der Grenze zwischen Kambodschas Provinz Banteay Meanchey und Thailands Sa Kaeo Provinz kam es zu einem Schusswechsel.
Kambodschas Darstellung: Laut kambodschanischen Behörden eröffneten thailändische Soldaten um 15:50 Uhr das Feuer auf kambodschanische Zivilisten im Dorf. Ein Zivilist, der 52-jährige Dy Nai, wurde getötet. Drei weitere Dorfbewohner wurden verletzt, darunter eine Frau und ein Jugendlicher.
Das kambodschanische Außenministerium sprach von einem „unprovzierten Angriff auf unschuldige Zivilisten“ und forderte Thailand auf, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen.
Thailands Darstellung: Thailand behauptete das Gegenteil: Kambodschanische Truppen hätten um 16:00 Uhr zuerst das Feuer eröffnet – von Positionen innerhalb des Dorfes aus. Thailand warf Kambodscha vor, Zivilisten als „menschliche Schutzschilde“ zu missbrauchen und militärische Positionen absichtlich in bewohnten Gebieten zu platzieren.
Das thailändische Militär veröffentlichte Luftaufnahmen, die angeblich kambodschanische Militärpositionen innerhalb von Prey Chan zeigen sollten.
Das umstrittene Dorf: Prey Chan selbst ist Teil des Problems. Das Dorf liegt in einem Grenzbereich, dessen genaue Zugehörigkeit seit Jahrzehnten umstritten ist. Auf kambodschanischen Karten gehört es eindeutig zu Kambodscha. Auf älteren thailändischen Karten liegt es auf thailändischem Territorium. Die Bewohner sind mehrheitlich Khmer und betrachten sich als Kambodschaner – aber das Gebiet wird von beiden Seiten beansprucht.
13. November – Evakuierung und Trauer
Am Tag nach dem Schusswechsel evakuierte Kambodscha etwa 250 Familien aus Prey Chan. Unter militärischer Eskorte wurden die Dorfbewohner zu einem buddhistischen Tempel transportiert, der 29 Kilometer von der Grenze entfernt liegt.
Journalisten berichteten von herzzerreißenden Szenen: Weinende Kinder, alte Menschen, die sich weigerten, ihr Zuhause zu verlassen, verzweifelte Bauern, die ihr Vieh zurücklassen mussten.
Am Nachmittag trugen Dorfbewohner unter Tränen den Sarg von Dy Nai durch das halb verlassene Dorf zum Tempel. Der 52-jährige Bauer hinterließ eine Frau und drei Kinder. Seine Tochter sagte gegenüber Reportern: „Mein Vater wollte nur sein Feld bestellen. Er war kein Soldat. Warum musste er sterben?“
Diese Bilder gingen durch die kambodschanischen Medien und schürten anti-thailändische Stimmungen in der Bevölkerung.
14. November – Diplomatische Bemühungen
Angesichts der sich verschlechternden Lage griff Malaysias Premierminister Anwar Ibrahim persönlich ein. Am 14. November führte er Telefonate mit beiden Premierministern.
Nach den Gesprächen gab Anwar eine vorsichtig optimistische Erklärung ab: „Beide Seiten haben mir ihr Engagement für eine friedliche Lösung bekräftigt. Sie sind bereit, im Einklang mit dem Kuala Lumpur Accord zu handeln und weitere Eskalationen zu vermeiden.“
Anutin versicherte laut Anwar, Thailand wolle den Frieden, bestehe aber auf einer „unabhängigen Untersuchung des Landminen-Vorfalls“ durch eine neutrale dritte Partei.
Hun Manet betonte seinen Willen zur Deeskalation, forderte aber gleichzeitig die sofortige Freilassung der 18 kambodschanischen Gefangenen als „Zeichen des guten Willens“.
Ob diese diplomatischen Versicherungen zu konkreten Maßnahmen führen, bleibt abzuwarten. Die Erfahrung der letzten Wochen lehrt: Worte sind billig, Taten zählen.
Die aktuelle Lage – angespannt und unvorhersehbar
Stand heute (16. November 2025) ist die Situation äußerst angespannt:
Militärisch:
- Beide Seiten haben ihre Truppen an der Grenze verstärkt.
- Schwere Waffen, die eigentlich abgezogen werden sollten, stehen weiterhin in Position.
- Das thailändische Militär hat in mehreren Grenzbezirken erhöhte Alarmbereitschaft ausgerufen.
- Kambodschanische Einheiten führen verstärkte Patrouillen durch.
Humanitär:
- Hunderte Familien sind weiterhin evakuiert und leben in Notunterkünften.
- Schulen in der Grenzregion bleiben geschlossen
- Hilfsorganisationen haben nur eingeschränkten Zugang zu den betroffenen Gebieten
- Die 18 kambodschanischen Kriegsgefangenen sitzen weiterhin in thailändischer Haft.
Wirtschaftlich:
- Mehrere Grenzübergänge sind geschlossen oder nur eingeschränkt geöffnet.
- Der grenzüberschreitende Handel liegt weitgehend brach.
- Tausende Menschen auf beiden Seiten, die vom Grenzhandel leben, stehen vor dem Ruin.
Diplomatisch:
- Das Friedensabkommen ist faktisch suspendiert.
- ASEAN versucht zu vermitteln, hat aber keine Durchsetzungsmechanismen.
- Die USA und China mahnen zur Zurückhaltung, ohne aktiv einzugreifen.
- Das gegenseitige Vertrauen ist auf einem Tiefpunkt.
Warum ist der Frieden so fragil?
1. Keine Lösung der Kernfrage – das Friedensabkommen regelte Waffenstillstand und Deeskalation, aber nicht die territoriale Frage. Solange unklar bleibt, wem Orte wie Prey Chan gehören, wird es immer wieder zu Konflikten kommen.
2. Tiefes Misstrauen – beide Seiten misstrauen einander fundamental. Jeder Vorfall wird der anderen Seite als böswillige Provokation ausgelegt. Es gibt keine gemeinsame Faktenbasis.
3. Innenpolitischer Druck – Beide Premierminister stehen innenpolitisch unter Druck. Anutin muss sich gegenüber dem thailändischen Militär und Nationalisten behaupten. Hun Manet darf nicht als schwach gegenüber Thailand erscheinen. Kompromisse werden als Verrat ausgelegt.
4. Fehlende Durchsetzungsmechanismen – ASEAN kann vermitteln, aber nicht durchsetzen. Es gibt keine neutralen Beobachter an der Grenze, keine unabhängige Überwachung der Vereinbarungen. Verstöße haben keine Konsequenzen.
5. Die Landminen-Frage – alte Minen aus vergangenen Konflikten können jederzeit explodieren und jede Explosion kann als Beweis für neue Provokationen interpretiert werden. Solange die Grenzregion nicht vollständig geräumt ist, bleibt dieses Pulverfass.
Wie geht es weiter?
Die nächsten Tage und Wochen werden entscheidend sein. Mehrere Szenarien sind möglich:
Optimistisches Szenario: Malaysias Vermittlung trägt Früchte. Eine unabhängige Untersuchung des Landminen-Vorfalls wird vereinbart. Die 18 Gefangenen werden freigelassen als Zeichen des guten Willens. Die Deeskalation wird wieder aufgenommen. Längerfristig beginnen ernsthafte Verhandlungen über die territoriale Frage unter internationaler Vermittlung.
Pessimistisches Szenario: Die Spannungen bleiben hoch. Weitere Vorfälle, absichtlich oder versehentlich, führen zu neuen Eskalationen. Das Friedensabkommen wird formell aufgekündigt. Der Konflikt schwelt weiter oder flammt erneut auf.
Wahrscheinliches Szenario: Status quo. Die Lage bleibt angespannt, aber ohne sofortige Eskalation. Beide Seiten vermeiden weitere größere Zusammenstöße, aber auch echte Fortschritte bleiben aus. Der Konflikt wird „eingefroren“ – bis zum nächsten Vorfall.
Meine persönliche Einschätzung
Als jemand, der seit 17 Jahren in Kambodscha lebt, macht mich diese Entwicklung traurig und besorgt zugleich.
Die Menschen, die unter diesem Konflikt leiden, auf beiden Seiten der Grenze, wollen nichts anderes, als in Frieden leben, ihre Felder bestellen und ihre Kinder zur Schule schicken. Sie interessieren sich nicht für historische Ansprüche oder nationalistische Rhetorik. Sie wollen einfach nur in Ruhe gelassen werden.
Dy Nai, der am 12. November getötete Bauer, ist das Gesicht dieser Tragödie. Ein einfacher Mann, der zur falschen Zeit am falschen Ort war, in seinem eigenen Dorf.
Die Lösung kann nur sein: ernsthafte, internationale Vermittlung mit echten Durchsetzungsmechanismen. Eine verbindliche Grenzziehung unter Beteiligung des Internationalen Gerichtshofs. Und vor allem: der politische Wille auf beiden Seiten, den Frieden über nationalistische Punktgewinne zu stellen.
Fazit: Ein brüchiger Frieden
Die letzten 14 Tage haben gezeigt, wie fragil der im Oktober geschlossene Frieden ist. Eine Landmine, ein Schusswechsel, ein toter Zivilist und schon steht die Region wieder am Rand eines Konflikts.
Das „Kuala Lumpur Peace Accord“, das US-Präsident Trump als außenpolitischen Erfolg feierte, ist kaum das Papier wert, auf dem es geschrieben wurde, solange die Grundprobleme ungelöst bleiben.
Die Menschen an der Grenze, evakuierte Familien, verletzte Soldaten und trauernde Angehörige zahlen den Preis für politisches Versagen auf beiden Seiten.
Meine Hoffnung: Dass Vernunft siegt. Dass beide Regierungen erkennen, dass sie mehr verbindet als trennt. Dass wirtschaftliche Vernunft und menschliches Mitgefühl über nationalistische Rhetorik triumphieren.
Aber die Ereignisse der letzten zwei Wochen stimmen einen nicht optimistisch.
Titelfoto: The Phnom Penh Post