„Halte fest, was du hast!“, das war das Mantra meiner deutschen Erziehung. Besitz, Status, Kontrolle, Sicherheit – all das galt es, zu bewahren, zu verteidigen, zu vermehren. Loslassen? Das war Schwäche, Versagen, Aufgeben.
Nach 26 Jahren in Südostasien, umgeben von buddhistischer Lebensweise, habe ich eine völlig andere Perspektive entwickelt. Das buddhistische Konzept des Nicht-Anhaftens hat mir gezeigt: Wahre Freiheit entsteht nicht durch Festhalten, sondern durch Loslassen.
Das klingt paradox, fast esoterisch. Aber es ist eine der praktischsten Lebensweisheiten, die ich je gelernt habe, besonders mit über 50, wenn das Leben einen ohnehin zum Loslassen zwingt.
Was ist Nicht-Anhaftung?
Im Buddhismus gibt es ein zentrales Konzept: Upādāna – Anhaftung oder Klammern. Buddha lehrte, dass Anhaftung die Hauptursache für Leiden (Dukkha) ist.
Aber Vorsicht: Nicht-Anhaftung bedeutet nicht Gleichgültigkeit, Kälte oder sich um nichts zu kümmern. Es bedeutet nicht, keine Beziehungen zu haben oder nichts zu besitzen.
Nicht-Anhaftung bedeutet:
- Dinge wertschätzen, ohne von ihnen abhängig zu sein
- Menschen lieben, ohne sie besitzen zu wollen
- Ziele verfolgen, ohne am Ergebnis zu kleben
- Das Leben genießen, ohne es verzweifelt festhalten zu wollen
- Akzeptieren, dass alles vergänglich ist
Ein buddhistischer Mönch erklärte es mir einmal so: „Halte alles in deinem Leben wie einen Vogel in deiner offenen Hand. Nicht so fest, dass du ihn erdrückst – nicht so locker, dass er wegfliegt. Einfach da sein lassen, ohne zu klammern.“
Woran ich als Deutscher hing und warum
Als ich vor über zwei Jahrzehnten nach Südostasien kam, war ich ein typischer Deutscher: strukturiert, kontrollbedürftig, sicherheitsorientiert. Ich hing an vielen Dingen, ohne es zu merken:
Materielle Sicherheit – in Deutschland hatte ich einen gut bezahlten Job, eine Wohnung, Versicherungen für jeden erdenklichen Fall. Das gab mir das Gefühl von Kontrolle und Sicherheit.
Pläne und Kontrolle – ich wollte alles planen, kontrollieren, vorhersehen. Meine Zukunft sollte berechenbar sein. Karriere, Rente, Altersvorsorge.
Status und Identität – mein Job definierte mich. Mein Einkommen definierte meinen Wert. Was andere von mir dachten, war wichtig.
Erwartungen und Idealbilder – wie mein Leben „sein sollte“. Wie Beziehungen „funktionieren müssen“. Wie Erfolg „auszusehen hat“. Ich hatte feste Vorstellungen von allem und litt, wenn die Realität davon abwich.
Die Vergangenheit – ich hing an Erinnerungen, an „besseren Zeiten“, an dem, was hätte sein können. Die Vergangenheit war in meinem Kopf präsenter als die Gegenwart.
All diese Anhaftungen gaben mir scheinbare Sicherheit, machten mich aber unfrei, ängstlich und letztlich unglücklich.
Der erste Schritt: Auswandern als erzwungenes Loslassen
Meine Auswanderung nach Thailand 1999 war der erste große Loslassen-Moment, auch wenn ich das damals nicht so sah. Ich musste loslassen:
- Meinen Job und mein Einkommen
- Meine Wohnung und viele Besitztümer
- Mein soziales Umfeld
- Meine gewohnte Umgebung und Komfortzone
- Meine Pläne für die Zukunft
Rückblickend war es der Beginn meiner Befreiung.
Was Südostasien mich über Loslassen lehrte
Besonders hier in Kambodscha bin ich täglich von Menschen umgeben, die viel weniger besitzen als ich und oft viel zufriedener sind. Das war anfangs verwirrend, später erleuchtend.
Die Mopedfahrerin am Markt – sie besitzt ein altes Moped, ein paar Kleidungsstücke und ein winziges Zimmer. Trotzdem lächelt sie jeden Morgen, scherzt mit den Kunden und strahlt eine Lebensfreude aus, die ich bei vielen wohlhabenden Deutschen vermisse. Warum? Sie klammert nicht an dem, was sie hat und leidet nicht unter dem, was ihr fehlt.
Der alte Fischer – Seit Jahrzehnten fährt er aufs Meer. Manchmal fängt er viel, manchmal wenig. Er plant nicht, sorgt sich nicht, klammert sich nicht an Erwartungen. „Das Meer gibt, was das Meer gibt“, sagt er achselzuckend. Diese Gelassenheit gegenüber Unvorhersehbarem war mir fremd, ist mir aber zur Inspiration geworden.
Meine Partnerin – sie besitzt fast nichts, im materiellen Sinne. Aber sie ist zufriedener als die meisten Menschen, die ich kenne. Wenn etwas kaputtgeht, zuckt sie mit den Schultern. Wenn Pläne sich ändern, passt sie sich an. Diese Flexibilität, dieses Nicht-Klammern an Erwartungen, das hat mich schon immer zutiefst beeindruckt.
Was ich losgelassen habe und wie es mich befreit hat
Im Laufe der Jahre habe ich gelernt, immer mehr loszulassen. Nicht auf einen Schlag, sondern Schritt für Schritt. Und jedes Mal fühlte es sich zunächst wie Verlust an, wurde dann aber zu Befreiung.
Materieller Besitz
In Deutschland besaß ich eine komplett eingerichtete Wohnung. Möbel, Geschirr, Elektrogeräte, Bücher, Kleidung, alles, was man „braucht“. Heute besitze ich einen Bruchteil davon.
Was ich gelernt habe: Je weniger ich besitze, desto freier bin ich. Weniger Dinge bedeuten weniger Sorgen, weniger Wartung, weniger Ballast. Ich habe losgelassen und Leichtigkeit gewonnen.
Kontrolle über die Zukunft
In Deutschland plante ich Jahre im Voraus. Karriere, Rente, Absicherungen. In Südostasien habe ich gelernt: Die Zukunft ist unvorhersehbar, egal wie sehr man plant.
Was ich gelernt habe: Ich kann die Zukunft nicht kontrollieren und das ist in Ordnung. Statt Energie in Sorgen über das Morgen zu stecken, konzentriere ich mich aufs Heute. Das ist nicht Verantwortungslosigkeit, es ist Realismus. Ich bin bemüht, vernünftige Entscheidungen zu treffen, aber ich klammere mich nicht an bestimmte Ergebnisse.
Erwartungen an Beziehungen
Früher hatte ich klare Vorstellungen, wie Beziehungen sein „sollten“. Meine Partnerin „sollte“ so und so sein, sich so und so verhalten. Diese Erwartungen führten zu ständiger Enttäuschung.
Was ich gelernt habe: Menschen sind, wie sie sind, nicht, wie ich will, dass sie sind. Statt zu versuchen, andere zu ändern oder an meinen Idealbildern festzuhalten, akzeptiere ich sie, wie sie sind. Das hat meine Beziehungen entspannt und vertieft.
Status und fremde Meinungen
Damals in Deutschland war mir wichtig, was andere von mir dachten. Mein Job, mein Einkommen, mein Status – all das definierte meinen Wert in den Augen anderer (und meinen eigenen).
Was ich gelernt habe: Die Meinung anderer ist vergänglich und letztlich irrelevant. Ich bin wertvoll, egal was ich tue oder besitze. Diese Freiheit von fremden Erwartungen ist unbezahlbar.
Perfektion und Selbstkritik
Ich war immer hart zu mir selbst. Fehler waren inakzeptabel, Schwächen mussten verborgen werden, alles musste perfekt sein.
Was ich gelernt habe: Perfektion ist eine Illusion und Selbstkritik ist selbstzerstörerisch. Ich habe gelernt, meine Unvollkommenheit anzunehmen und damit auch die anderer. Das macht mich nachsichtiger, sowohl mit mir als auch mit anderen.
Die Vergangenheit
Lange Zeit hing ich an der Vergangenheit. An Erinnerungen an „bessere Zeiten“, an Bedauern über Entscheidungen, an „Was wäre wenn?“-Szenarien.
Was ich gelernt habe: Die Vergangenheit existiert nur in meinem Kopf. Sie ist vorbei, unwiderruflich. Daran festzuhalten raubt mir die Gegenwart. Loslassen der Vergangenheit hat mich ins Jetzt gebracht und das Jetzt ist alles, was wirklich existiert.
Praktische Übungen zum Loslassen
Loslassen ist keine einmalige Entscheidung, sondern eine tägliche Praxis. Hier sind Übungen, die helfen können:
- Die Meditation des Loslassens – setze dich hin, schließe die Augen. Identifiziere, woran du gerade klammerst: eine Sorge, eine Erwartung, ein Ärgernis. Stell dir vor, wie du es wie einen Ballon loslässt und davonfliegen siehst. Atme aus und lass los.
- Der tägliche Verzicht – einmal pro Woche bewusst auf etwas verzichten, an dem man hängt, ein Genussmittel, eine Gewohnheit, ein Besitztum. Das übt Nicht-Anhaftung im Kleinen.
- Die „Was solls“-Übung – Wenn etwas schiefgeht oder nicht nach Plan läuft, sich fragen: „Was solls? Was ist das Schlimmste, das passieren kann?“ Meist ist es nicht so dramatisch, wie der Kopf es macht. Das relativiert und hilft beim Loslassen von Erwartungen.
- Das Akzeptanz-Mantra – „Es ist, wie es ist.“ Dieser einfache Satz hat enorme Kraft. Statt gegen die Realität anzukämpfen, akzeptiere ich sie und handle dann klug von dieser Akzeptanz aus.
- Dankbarkeit für Vergänglichkeit – alles ist vergänglich, aber gerade deshalb kostbar. Der Sonnenuntergang ist schön, weil er nicht bleibt. Die Zeit mit geliebten Menschen ist wertvoll, weil sie endlich ist. Diese Perspektive macht Vergänglichkeit vom Feind zum Freund.
Die Paradoxie des Loslassens
Das Verrückte: Je mehr ich loslasse, desto mehr gewinnt man.
- Je weniger ich an Besitz klammere, desto reicher fühle ich mich.
- Je weniger ich Kontrolle will, desto mehr Ruhe habe ich.
- Je weniger ich von anderen erwarte, desto bessere Beziehungen habe ich.
- Je weniger ich mich an Pläne klammere, desto mehr überrascht mich das Leben positiv.
- Je mehr ich die Vergänglichkeit akzeptiere, desto intensiver lebe ich.
Loslassen ist keine Resignation. Es ist keine Gleichgültigkeit. Es ist das Gegenteil: Es ist aktive Freiheit. Die Freiheit, das Leben zu nehmen, wie es kommt – und trotzdem (oder gerade deshalb) dankbar und glücklich zu sein.
Was ich nicht loslasse
Wichtig zu betonen: Nicht-Anhaftung bedeutet nicht, an nichts mehr Wert zu legen.
Ich lasse nicht los:
- Meine Werte und Prinzipien
- Meine Liebe zu den Menschen, die mir wichtig sind
- Mein Engagement für Dinge, die mir am Herzen liegen
- Meine Freude am Leben
Aber ich klammere mich nicht daran. Ich halte sie in offener Hand, wie den Vogel, den der Mönch beschrieb. Da, aber nicht besessen. Geschätzt, aber nicht verzweifelt festgehalten.
Fazit: Loslassen als Lebenskunst
Loslassen lernen war und ist eine der wertvollsten Lektionen meines Lebens. Die buddhistischen Kulturen Südostasiens haben mir dabei geholfen, nicht durch Vorträge oder Bücher, sondern durch gelebtes Beispiel.
Mit über 50 wird mir immer klarer: Das Leben ist ein ständiges Üben im Loslassen. Jugend, Gesundheit, Menschen, Besitz, Pläne – alles entgleitet, früher oder später. Man kann dagegen ankämpfen und leiden – oder man kann loslassen und frei sein.
Ich habe mich für Letzteres entschieden. Und ich habe noch nie so viel Frieden und Zufriedenheit empfunden wie jetzt, wo ich am wenigsten festhalte.
„Halte fest, was du hast“ – das war das deutsche Mantra meines Lebens in Deutschland. „Lass los, was du nicht halten kannst“, das ist das buddhistische Mantra meines Lebens in Südostasien geworden.
Und es macht einen großen Unterschied.




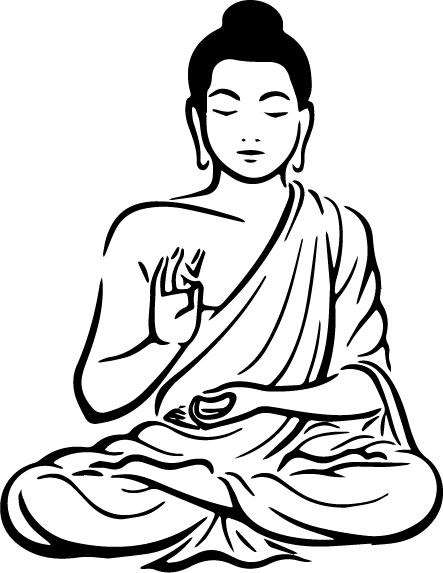




Ein Kommentar
Gute Erkenntnis. Das ist der Kern aller buddhistischer Richtungen: Letting go!
Gratuliere